|
 
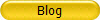
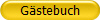
| |
|
Geschichte der Stadt
Vohenstrauß
| 1124 |
Bischof Otto von
Bamberg weiht die Kirche zu "Vohendreze"
(Altenstadt bei Vohenstrauß).
|
| 1230 |
Altenstadt wird schon
als "veteri (=altes) vohendrezz" bezeichnet. Die Staufer
gründeten die neue Marktanlage vermutlich Anfang des 13. Jhs.
|
| 1280 |
Das Salbuch Herzog
Heinrich XIII. von Niederbayern erwähnt erstmals den "marcht
ze Vohendraetz, di stewer, daz gericht und alle Sache".
|
| 1329 |
Durch den Hausvertrag
von Pavia fallen Floß, Parkstein und Vohenstrauß an die pfälzischen
Wittelsbacher. Auch danach ist Vohenstrauß immer wieder von den
wittelsbachischen Länderteilungen betroffen.
|
| 1378 |
Am 25. Oktober
verleihen die Herzöge Otto V., ehemaliger Markgraf von Brandenburg
und Friedrich der Weise von Bayern-Landshut ihren "Getreuen der
Stadt Vohendres" einen Jahrmarkt am Sonntag nach St. Galli.
Vohenstrauß wird erstmals als Stadt erwähnt.
|
| 1569 |
Pfalzgraf Friedrich
(1557-1597) erbt das Amt Floß-Vohenstrauß sowie den Hälfteanteil
des Gemeinschaftsamts Parkstein-Weiden.
|
| 1585 |
Pfalzgraf Friedrich wählt
den Markt Vohenstrauß als Sitz seiner künftigen Residenz und baut
die Friedrichsburg (1586-1592). |
| 1777 |
Der letzte
Sulzbacher, Karl Theodor, vereinigt nach dem Erlöschen der
bayrischen Kurlinie die Pfalz mit Bayern. Vohenstrauß wird
bayrisch.
|
| 1809 |
Vohenstrauß wird
Sitz des Landgerichts, im Jahre 1842 folgt das Rentamt.
|
| 1862 |
Die Friedrichsburg wird
auch Sitz des Bezirksamts. |
| 1912 |
Vohenstrauß wird wieder
zur Stadt erhoben. |
| 1972 |
Die ehemals eigenständigen
Gemeinden Altenstadt, Böhmischbruck, Kaimling, Oberlind,
Roggenstein und Waldau werden eingegliedert.
Der Landkreissitz
wird nach Neustadt a. d. Waldnaab verlegt.
|
|
Quelle: Vohenstrauß im Wandel der
Zeiten, 1978, u.a. S. 176 ff. |
|
|
Vohenstrauß - eine
Wittelsbacher Residenz
Pfalzgraf Friedrich von
Vohenstrauß (1557 - 1597)
Pfalzgraf
Friedrich von Vohenstrauß, am 11. August 1557 im rheinpfälzischen
Meisenheim geboren, war der Erbauer der Friedrichsburg (1586 - 1593).
Als
vierter Sohn des Pfalzgrafen Wolfgang von Zweibrücken-Veldenz erbte er
das Pflegamt Flossenbürg mit den Märkten Vohenstrauß und Floß sowie
die halbe Herrschaft Weiden-Parkstein.
Er
heiratete 1587 die Fürstin Katharina Sophia von Liegnitz, Tochter des
schlesischen Herzogs Heinrich XI. und dessen Gemahlin Sophia, geborene
Markgräfin von Brandenburg.
Ihre
drei Kinder, Anna Sophia und die Zwillinge Georg Friedrich und Friedrich
Kasimir, starben noch im Säuglingsalter.
Der
Markt Vohenstrauß erlebte während Friedrichs Regierungszeit einen
bedeutenden wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung.
Der
Pfalzgraf starb am 17. Dezember 1597 auf der Friedrichsburg, desgleichen
seine Frau im Jahre 1608, womit die Eigenschaft des Marktes Vohenstrauß
als pfalzgräfliche Residenz endgültig erlosch.
|

|
|
|
 |
Die "Spießbürger"
von Vohenstrauß
Verteidigung und Landwehr
Schon
zur Zeit der Hussiteneinfälle im 15. Jh. gab es die Landwehr.
Zu
den Waffen gehörte die Pike, ein 3,5 bis 4 Meter langer Spieß, im späten
Mittelalter die Hauptwaffe des Fußvolks.
In
einem Musterungsregister von 1565 finden sich die Namen der Vohenstraußer
Schützen mit "Haubenhacken" und "Wehren". 1599 zählte
Vohenstrauß 123 landwehrfähige Männer.
Zur
Ausrüstung gehörten u.a. Krebs, Kragen, Häubl, Hellebarde und Büchse.
Die
zum Wehrdienst Berufenen wurden jeden Sonntag nach dem Gottesdienst zu
einer Übung mit Pike oder Muskete verpflichtet. Der Schießplatz lag am
Oberlinder Weg.
Auch
das Büchsenmacherhandwerk wird anno 1713 in unserer Stadt nachgewiesen.
Im
19. Jh. war Vohenstrauß Sitz eines Landwehrbataillons. Dieses 1808 gegründete
Bürgermilitär diente vor allem der Aufrechterhaltung der inneren
Sicherheit.
Mit
der Heeresreform von 1868 wurde die Landwehr aufgehoben und diese
Bezeichnung für die älteren Jahrgänge der Reserve verwendet.
|
|
|
|
Recht und Ordnung in
alter Zeit
Der
Markt Vohenstrauß war schon am Ende des 13. Jhs. Sitz eines
Niedergerichts. Das Hochgericht übte der Landrichter in Sulzbach aus.
Im
15. Jh. gewann Vohenstrauß ein eigenes Hochgericht, das von zwölf
geschworenen Bürgern unter dem Vorsitz des herrschaftlichen Richters
besetzt war. Sein kleiner Sprengel umfaßte den Markt selbst, dazu
Altenstadt und einige Anwesen um Vohenstrauß.
Schwere
Verbrechen wie Mord, Meineid, Notzucht oder Diebstahl wurden an den drei
"Ehafttagen" im Jahr abgeurteilt.
Die
Siedlung Galgenberg und das Galgenholz zwischen Vohenstrauß und Weißenstein
erinnern noch an die damalige Richtstätte.
Ab
1799 führte der Richter zu Vohenstrauß den Titel
"Landrichter".
Im
Jahr 1803 wurde aus den Landrichterämtern Treswitz, Tännesberg,
Leuchtenberg, Vohenstrauß und Pleystein sowie den Richterämtern
Miesbrunn, Burkhardsrieth und Waidhaus das Landgericht älterer Ordnung
Treswitz gebildet, das 1809 nach Vohenstrauß verlegt wurde.
Als
erster Richter des Landgerichts Vohenstrauß war der königliche
Landrichter Erhard Haunold tätig.
|


|
|
|
 |
Religiöse Volkskunst
Volksglaube
und Brauchtum sind der Ursprung aller religiösen Volkskunst. Sie wird
heute geschätzt wegen ihrer naiven und unmittelbaren Ausdruckskraft. Ihre
Schöpfer bleiben vorwiegend unbekannt. In unserem konfessionell
gemischten Raum findet sie Niederschlag im Kunsthandwerk. Vorwiegend
heimische Schnitzereien und Arbeiten aus Schmiedeeisen werden ergänzt
durch Hinterglasbilder aus Winklarn und dem Böhmerwald.
Kruzifix
und Heiligenbilder schmückten den Herrgottswinkel des katholischen Bürgerhauses.
In
der evangelischen Familie bildete die Lutherbibel den religiösen
Mittelpunkt.
|
|
|
|
|
|
|
|
