|
 
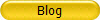
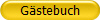
| |
|
Der Pflug - Symbol bäuerlicher
Arbeit
Der
Pflug galt jahrhundertelang als Symbol bäuerlicher Arbeit. Seine
wichtigste Arbeit ist das Umackern des zur Bebauung vorgesehenen Feldes.
Die
Bodenbearbeitung erfolgte zu Beginn unseres Jahrhunderts beispielsweise
folgendermaßen:
Die
nach zweimaliger Getreideernte ausgeruhte Brache düngte man mit Mist.
Im
Juli, zwischen Heu- und Getreidernte, ackerte man zum ersten Mal, was man
"abrainen" nannte.
Später
wurde zum zweiten Mal geackert, dies hieß "ausfangen".
Im
Herbst vor der Aussaat erfolgte eine dritte Pflugfurche. Dann wurde der
Roggen gesät und
der
Samen leicht eingeackert. Bei dieser Anbaumethode stand das Getreide auf
schmalen Erdbeeten, den Bifängen.
Diese
wechselten mit Furchen ab, um das Wasser in den damals nicht drainierten
Feldern abzuleiten.
|
|
Zur Statistik der
Haushaltungen mit Oekonomiebetrieb (1873)
"Die
Zahl der Haushaltungen mit Oekonomiebetrieb im ganzen Physikatsbezirke (=
Altlandkreis Vohenstrauß) beläuft sich auf 2751 und es treffen auf 1
Haushaltung mit Oekonomiebetrieb
| 14 Tgw. |
83 Dec. |
Aecker, |
| 8
" |
23 Dec. |
Wiesen, |
| -
" |
23 Dec. |
Gärten, also |
| 23 Tgw. |
29 Dec., |
|
welche
Zahl auch das richtige Mass für die meisten Oekonomen sein wird."
Durchschnittlich
werden in einem solchen Betrieb auch etwa 5 Stücke Rindvieh und 1 - 2
Schweine gehalten.
"Die
Stallungen für das Rindvieh, welche meistens mit dem Wohnhause unter
einem Dach sich befinden, sind gewöhnlich niedrig, klein, meist überfüllt
und ohne alle künstliche und natürliche
Ventilation."
|


|
|
|
|
Die Lerau - das Tal der
Mühlen
Die
Lerau entspringt im Waldgebiet des Fahrenbergs und mündet bei der Burgmühle
unterhalb von Leuchtenberg in die Luhe. Auf einer Länge von etwa elf
Kilometern hat sie ein Gefälle von 184 Metern. Das reichte aus, um früher
bis zu vierzehn Mühlenbetriebe mit Energie zu versorgen.
Franz
Xaver von Schönwerth erwähnte in seinen Weissagungen vom Kalten Baum
eine fürchterliche Schlacht, "wovon so arges Blutvergiessen gegen
Norden hin entsteht, daß es die Mühle im Thale bey Lind treibt."
Gemeint war damit die Tradmühle zwischen Ober- und Unterlind.
Der
Besitzer des Anwesens, Konrad Wildenauer, schenkte 1988 die Mühleneinrichtung
dem Museum.
Die
Zeit der durch Wasserräder angetriebenen Mühlsteine, mit denen das Korn
in jahrhundertealter Technik zu Mehl bereitet wurde, ist endgültig
vorbei.
|
|
|
|
Die Tradmühle mit einem
"Gang"
Ein
vertikal gestelltes Wasserrad setzte den Wellbaum in Bewegung.
Das
daran befestigte Kammrad griff mit seinen seitlich angebrachten Kämmen (Zähnen)
in ein waagrecht laufendes gusseisernes Zahnrad.
Damit
wurde der Antrieb auf die waagrechte Ebene umgelenkt.
Ein
weiter oben mitlaufendes Kammrad übertrug die Kraft auf die Mühlstange.
Diese
drehte den in der dreiarmigen Flügelhaue aufgehängten Läuferstein über
dem festliegenden Bodenstein.
Das
Getreide wurde über die Gosse und den Rüttelschuh durch das Mittelloch
des Obersteins dem Mahlgang zugeführt.
Das
Mahlgut musste zum
-
Putzen (Keimling, Schmutz vom Korn entfernen),
-
Koppen (Spitzen entfernen),
-
Quetschen (Schälen des Kerns) und
-
Ausmahlen
wiederholt
den Mahlgang passieren.
"Achtmal
will das Mahlgut seinen Herrn sehen", sagt ein altes Sprichwort.
|

|
 |
"Kein Beck soll
eine eigene Mühl haben"
Die
Zünfte der Bäcker und Müller hatten in Vohenstrauß eine gemeinsame
Handwerksordnung. Sie ist uns aus dem Jahr 1657 erhalten.
Wollte
einer Meister werden, musste er bei der Zunft einen Geburts-, Lehr- und
Wanderschaftsbrief vorlegen. Dazu musste er verheiratet und hausfleißig
sein.
Das
vorgeschriebene Meisterstück musste er in fremder Werkstatt vor den
geschworenen Zunftmeistern machen.
Der
Müller hatte ein paar Mühlsteine auszuhauen und aufzuziehen, ein paar
Triebscheiben oder
ein
Kumpf (= Getriebestock) vorzusetzen, ein neues "Kämb"
auszuschneiden und zu schlagen und ein neues "Geschäufel" zu
machen.
Noch
1671 wurden die Müller zur Aufstellung des Galgens mit herangezogen. Sie
zählten deshalb zu den "unehrlichen" Berufen.
|
|
|
Ausnahmepakt (Übergabevertrag)
"zwischen
Dorothea
Pößlin und deren Sohn Georg Pößl
zu
Altenstatt vom 25. April 1765
...
Zweitens für die Speise hat die Verkäuferin alljährlich ausgenommen:
4
Achtl Korn, 6 Napf Weizen, 1 Achtl und 2 Napf Gerste und 4 Napf Haber, ...
...
Fünftens ist bedungen worden, daß, wenn die Verkäuferin die Kuh nicht
mehr halten will, der Käufer ihr jährlich 6 Maß Schmalz geben muß und
von Mitterfasten bis St. Michaelis täglich 1 Seidl Milch, nach St.
Michaelis aber wöchentlich, solang die Kühe noch proportionierte Milch
geben, 1 Maß Milch, wie sie von der Kuh kommt;
des
weiteren, wenn sie die Hennen nicht mehr halten wolle, jährlich 2
Schilling Eier zu bekommen habe.
...
Sechstens an Feld hat die Verkäuferin ausgenommen
5 Beet zu Kraut und Rüben,
5 Beet zu Erdäpflen,
das benötigte Feld zu 1 Napf Lein und
2 Beetl im Samgarten zu Pflanzen oder Salat, ... "
1
Napf = ca. 20 Pfund, je nach Getreideart
1
Schilling = 30 Stück
|
|
|
|
Maße und Gewichte
In
früheren Jahrhunderten machte die "Messerei" große
Schwierigkeiten, verursacht durch viele verschiedene örtliche Maße. Fast
jedes Pflegamt hatte sein eigenes Achtel oder Viertel. Man unterschied
zwischen dem rauhen Achtel, das für Hafer, Gerste und Gemischtes
angewendet wurde und dem glatten Achtel für Korn oder Weizen.
Kleinere
Mengen (Leinsamen, Mohn) maß man mit dem Metzen, der 8 Maß enthielt.
Im
Jahre 1765 wurde als Richtmaß das Sulzbacher Stadtmaß bestimmt, wobei
nebenbei häufig die örtlichen Maße beibehalten wurden.
Beispiele
1
Achtel = 1 1/2 Viertel
1
Achtel = 8 Napf
1
glattes Viertel = 8 Metzen
1
rauhes Viertel = 10 Metzen
1
Scheffel = 6 Metzen
1
Metzen = 8 Maß (ca. 37 l)
Aus
diesen alten Maßeinheiten sowie dem "Fuß" und der
"Elle" entwickelte sich allmählich das genormte metrische Maßsystem,
das in Deutschland seit 1872 gilt.
|
 |
 |
Die Mechanisierung der
Hausarbeit
Es
war Aufgabe der Frau, die Küche und das Vieh zu versorgen, auch nach
Bedarf auf dem Feld mitzuhelfen und Handarbeiten herzustellen.
Auf
die Reinlichkeit der Wohnungen, der Leib- und Bettwäsche sowie der
Kleidung wurde noch um 1860 sehr wenig Wert gelegt. Ursachen dafür waren
die beengten Verhältnisse, mangelndes hygienisches Verständnis und die
zeitraubende, beschwerliche Arbeit von Hand.
Nur
langsam wurden am Ende des 19. Jhs. technische Neuerungen auch in der
Haushaltsführung
wirksam.
Vornehmlich sind hier die zunehmende Verwendung der Nähmaschine, die
Nutzung der Elektrizität und die Vervollkommnung der Waschmaschine zu
nennen.
Aber
erst nach 1950 entfaltete sich die bis dahin noch karg einsetzende
Mechanisierung der Hausarbeit.
|
|
|
|
Entlohnung der
Dienstboten
"Die
Victualienpreise lassen die Verköstigung für die Dienstboten und Taglöhner
im Jahre 1875 auf einen Tag in nachstehender Weise berechnen: |
|
Frühstück
2 kr.
Mittag
12 kr.
Abends
6 kr.
Brod
4 kr.
Getränk
3 kr.
__________________
Summa
27 kr.
pr.
Tag
für
1 Dienstboten. |
|
|
Hiernach
ergibt sich
für
einen Knecht
jährl.
Verköstigung 164
fl.
Lohn
(50 - 100 fl.)
75 fl.
Zugeding:
2
Hemden à 2 fl. =
4 fl.
3
Schürze à 30 kr. =
1 fl. 30 kr.
Christgeschenk
30 kr.
___________________________
in
Summa
245 fl.
|
für
eine Magd
jährl.
Verköstigung 164
fl.
Lohn
(25 - 55 fl.)
40 fl.
Zugeding:
25
- 35 Ellen Tuch,
durchschn.
30 Ellen
à
27 kr. =
13 fl. 30
kr.
Leinausbau,
Werth
12 fl.
Marktgeschenke
ca.
3 fl.
__________________________
in
Summa
232 fl. 30
kr."
|
|
|
|

|
Flachs - Sache der
Frauen
"...
wird der Leinbau stark betrieben und zwar einestheils aus Bedürfnis, da
die ländliche Bevölkerung fast ganz Kleider aus Leinenstoffen trägt,
anderntheils weil das Erträgniss aus dem Flachsbau eine Einnahmsquelle
der Hausfrau (quasi Nadelgeld) bildet, indem sie denselben entweder als
Flachs bearbeitet oder als Leinwand verkauft.
Das
Pfund Flachs kostet ungehechelt 24 - 33 kr. die Elle Leinwand von 24 - 42
kr., das Schäffel Leinsamen von 19 - 22 fl."
Dr.
Seb. Wallner (1876)
Anm.: 1 bayr. Elle = ca.
83,3 cm
1 bayr. Schäffel = 2,224
hl
|
|
Flachs und Leinen
Der
Flachs oder Lein, eine Faserpflanze, wurde nach den Eisheiligen gesät.
Nach der Reife, Mitte August, musste er mit der Hand ausgezogen
("gerauft") und gebündelt werden.
Um
die Samenkapseln abzustreifen, wurde er "geriffelt" und anschließend
2 - 3 Wochen "geröstet", d. h. in der "Flachsröstgrube"
gewässert und mit Steinen beschwert, um die Fasern von den Holzteilen des
Stengels zu lösen.
Nun
wurde der gebündelte Flachs im Backofen getrocknet, danach in die
"Breche" gesteckt.
Um
den Flachs endgültig zu säubern, wurde er mit dem Schwingholz geschlagen
und durch anschließendes "Hecheln" gekämmt.
Der
gehechelte Flachs kam auf den "Spinnrocken". Dort wurden die
Fasern zu einem Faden gedreht und auf die sich drehende Spule des
Spinnrades geleitet.
Das
so gedrehte Garn wurde auf die Haspel gewickelt.
Nun
konnte das Garn zu Leinen verwebt werden.
|
 |
|
Kleidung
Die
Bestandteile der ländlichen Kleidung des 17./18. Jahrhunderts lassen sich
in der Oberpfalz nur durch Bildquellen (z. B. Votivbilder in der
Wieskirche bei Moosbach) erschließen.
Die
Oberpfälzer Tracht, bestimmt durch die Einfachheit und Härte des täglichen
Lebens, war bescheiden und unauffällig.
Zum
Mann gehörten der mantellange, dunkle "Rock", die rote Weste
und die knielange Leder- oder Stoffhose.
Die
Frauentracht bestand aus dem gefältelten oder gerüschten Leinenrock, dem
Mieder mit dickwattierten Bauschärmeln und der breiten, seidenen Schürze,
dem Fürtuch.
|
|
Riegelhauben
Die
Riegelhaube war in unserem Raum ebenfalls Bestandteil der Tracht. Die
brokatenen Riegelhauben wurden seit 1830 ausschließlich zu festlichen
Gelegenheiten getragen.
Die
goldenen Riegelhauben trug man beispielsweise zur Primiz, Taufe und
Hochzeit, die silbernen an Ostern, Fronleichnam und Pfingsten. Sie
bedeckten als sogenannte Nesthauben nur die hintere Kopfpartie.
Um
1860 kamen die Hauben gänzlich außer Gebrauch und wurden vom Kopftuch
ersetzt.
|
|
|
