|
 
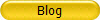
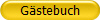
| |
|
Der Weg ins
Industriezeitalter
Den
wirtschaftlichen Schwerpunkt des nordostoberpfälzischen Raumes haben wir
zu Beginn des Industriezeitalters in der Glas- und Porzellanindustrie zu
suchen.
Die
Erfindung der Dampfmaschine leitete dabei die klassische industrielle Ära
ein. Die entstehenden "Manufacturen" und Fabriken wurden unabhängig
von Wasserführung und Verlauf eines Baches oder Flusses.
Die
Veränderung der Erwerbsstruktur zeigt sich am auffälligsten im
Niedergang der heimischen Weberei, die hauptsächlich in
"Heimarbeit" neben der Landwirtschaft betrieben wurde.
Durch
die Schaffung neuer Arbeitsplätze mussten aber auch weniger Menschen
auswandern.
1855
waren in den hiesigen Schleif- und Polierwerken sogar 107 böhmische
"Gastarbeiter" tätig, die über die Grenze pendelten.
Mit
der Fertigstellung der Eisenbahn (1886),
der
Gründung der Porzellanfabrik (1901)
und
der Einführung der "Electricität" (1904)
wurde
der endgültige Schritt in die Industriegesellschaft auch in Vohenstrauß
vollzogen.
|
|
|
|
"Kuchlgschirr"
und andere Hafnerware
Beim
Töpfern begegnen wir einer der ältesten und ursprünglichsten Betätigungen
des Menschen. Dabei spielen die volkstümlichen vier Elemente Erde,
Wasser, Luft und Feuer eine nicht wegzudenkende Rolle:
 |
Die
Erde - Ton oder Lehm - ist das Urmaterial.
|
 |
Durch
das Wasser lässt sich der Ton formen.
|
 |
Das
Trocknen an der Luft ist Voraussetzung für das sich daran anschließende
Brennen.
|
 |
Erst
durch das "feurige Element" gewinnt der aus Ton geformte
Gegenstand seine endgültige und dauerhafte Gestalt.
|
In
der Vohenstraußer Häuserliste von 1590 wird unter 26 Berufen auch der
Hafner aufgeführt.
Unter
dem Oberbegriff Keramik unterscheiden wir je nach Art des Tons und der
Brenntemperatur
hauptsächlich
sechs Arten: Irdenware, Terrakotta, Fayencen, Steingut, Steinzeug und
Porzellan.
|
 |
|
Porzellan - das
"weiße Gold"
"Die
allerschönste irdene Waare ist das Porcellan, welches noch vor 120 Jahren
aus China und Japan zu uns gebracht wurde, bis es einem Sachsen gelang,
Porcellan zu verfertigen, das dem chinesischen nicht nachsteht."
(Gailer,
1835)
Gegenüber
anderen keramischen Massen hat die Porzellanmasse (Kaolin, Quarz und
Feldspat) einen höheren Kaolin- und Feldspatanteil. Sie kann deshalb höher
und härter gebrannt werden.
Wie
die Glasherstellung fußt auch die Porzellanindustrie auf heimischen
Bodenschätzen.
Dabei
erlangten die nordoberpfälzischen Porzellanfirmen mit ihren hochwertigen
Erzeugnissen durchaus Weltruf.
|
 |
Porzellanfabrik
Johann Seltmann
Vohenstrauß
Der
Gutsbesitzer Johann Seltmann (1856-1921) gründete die Porzellanfabrik im
Jahr 1901 in der Gemarkung Altenstadt bei Vohenstrauß.
Für
die Wahl dieses Standortes sprach die damalige Verlängerung der Bahnlinie
von Vohenstrauß nach Waidhaus und damit eine mögliche Weiterführung der
Strecke zu den Rohstofflagern in Böhmen. Zunächst konnten die meisten
Rohstoffe im nahen Oberpfälzer Raum bezogen werden.
Daneben
verfügte das Bezirksamt über ein unerschöpfliches Angebot an billigen,
anlernbaren Arbeitskräften.
Der
Betrieb war von Beginn an der größte Arbeitgeber im Bezirksamt
Vohenstrauß.
Im
Jahr ihres 25jährigen Bestehens war die Porzellanfabrik Johann Seltmann
ein Unternehmen von Weltgeltung mit 600 Beschäftigten.
1975
wurde der Familienbetrieb in eine GmbH umgewandelt.
Leider
haben es unsere "Porzelliner" nicht geschafft, sich trotz
Modernisierung und Rationalisierung
auf
dem Weltmarkt zu behaupten.
|
|
|
|
Die Entwicklung der
Glasindustrie in und um Vohenstrauß
Die erste
Glashütte der Oberpfalz in Frankenreuth
Die
erste nachweisbare Glashütte in der Oberpfalz bestand bereits im Jahre
1487 in Frankenreuth bei Waidhaus. Im Volksmund war sie als Schedelhütte
bekannt. Die Gründung dieser Hütte liegt sicherlich noch weiter zurück,
denn bei der ersten urkundlichen Nennung handelt es sich um einen Erbbrief
des Pfalzgrafen und Herzogs Otto an einen Hans Glaser.
Nicht
weit entfernt wurden 1585 von einem Hans Reichenberger zwei Glashütten in
dem nach seiner Familie benannten Rodungsgebiet Reichenau errichtet.
Die
letzte dieser beiden Glashütten ließ Graf Mansfeld im Jahre 1621
vernichten.
|
|
|
|
Vom Hammerwerk zur
Glasschleife
Während
der Blütezeit des Oberpfälzer Bergbaus von der Mitte des 14.
Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts, entstand in unserer Region
ein weitläufiges Netz von Eisenhämmern entlang der vielen Bach- und
Flussläufe.
Wirtschaftspolitische
Fehlentscheidungen, technische Umwälzungen und zunehmende europäische
Konkurrenz, überlagert durch die katastrophalen Wirkungen des
ausbrechenden Dreißigjährigen Krieges, führten schließlich zum
Niedergang des Oberpfälzer Montanwesens zu Beginn des 17. Jahrhunderts.
Die
Hammerwerke wurden großenteils in Säge- und Papiermühlen,
Glasschleifen, Spiegelschleif- und Polierwerke umgewandelt, die ebenfalls
das Wasser als Antriebskraft nutzten. Dabei sparten die neuen Werke einen
großen Teil der Einrichtungskosten, denn die Anlagen für die Übertragung
der Wasserkraft waren ja bereits vorhanden.
|
 |
 |
Schleif- und Polierwerke
Um
1705 wurde die Technik des Spiegelschleifens aus Frankreich in die
Oberpfalz eingeführt.
Ehemalige
Eisenhämmer und Mühlen entlang von Zott, Pfreimd und Tröbesbach wurden
in Glasschleifen umgebaut.
Der
Landsasse Leonhard A. v. Voith baute 1749 seine Mühle und Schneidsäge in
eine Glasschleife um.
1870
gab es im Bezirk Vohenstrauß 25 Schleif- und Polierwerke mit 335 Beschäftigten,
die sich bis 1895 auf 44 Betriebe mit insgesamt 631 Arbeitskräften erhöhten.
Sie waren hauptsächlich Zulieferer
der
Fürther Flachglasindustrie.
Im
Jahre 1928 wurde in Weiden eine Glasfabrik auf das neue Ziehglasverfahren
umgestellt. Die erzeugte Glasqualität machte das Schleifen und Polieren
überflüssig. Nur noch hochwertiges Spiegelglas wurde nach der herkömmlichen
Methode bearbeitet.
|
|
Aus Berichten der
Fabrikinspektoren im Jahre 1881
"Von
den Glasschleifern und Glaspolirern zu Altenhammer, B.-A. Neustadt wurden
nach Dr. Greiner
in
Floß 29 % behandelt und zwar meist an Krankheiten der Respirationsorgane
(Athmungsorgane), da die Arbeiter durch Inhalation von Quarzstaub, die
Polirer durch Inhalation (Einathmung), von Eisenstaub (Eisenoxyd) leiden.
Die
Arbeiter in der Glashütte "Annahütte" im B.-A. Eschenbach, 21
an der Zahl, sind nach Bezirksarzt Dr. Herman von schwacher Muskulatur in
Folge des häufigen Nachtdienstes (8 mal im Monat); sie verdienen täglich
bis 2 Mark.
Die
Glasfabrik in Frankenreuth B.-A. Vohenstrauß, beschäftigt in 34
Glasschleifen und Polirwerken
zusammen
393 Arbeiter, von welchen ein Drittheil weiblichen Geschlechts ist. Davon
starben im Berichtsjahr 11, die meisten an Lungenkrankheiten."
Bruno
Schoenlank (1859 - 1901)
|
|
 |
Neubeginn der
"Glasmacher"
Nach
Ausbruch des 2. Weltkriegs kamen die Polieren alle zum Stillstand. Mit der
Umwandlung der stillgelegten Danzerschleife an der Zott wurde der
Grundstein für die Hohlglasveredelung im ehemaligen Landkreis Vohenstrauß
gelegt.
Von
Juni 1946 bis November 1947 ließen sich zehn aus der Tschechoslowakei
vertriebene sudetendeutsche Glasraffineure aus dem Gebiet um
Haida-Steinschönau in der Stadt und im Landkreis Vohenstrauß nieder.
Am
30. Januar 1950 wurde die Kristallglasfabrik "Füger und Taube"
mit 140 Arbeitern eröffnet. Durch die Hohlglasproduktion dieser Hütte
stieg die Anzahl der Glasraffinerien in der Stadt und dem Umland bis 1953
auf insgesamt 23 an.
In
einem 1954 von der Stadt Vohenstrauß herausgegebenen "Merkblatt für
Industrieansiedlung" bezeichnet man sich selbst als eine Stadt, die
sich "nun von einem Schwerpunkt zum Zentrum der Haida-Steinschönauer
Glasindustrie entwickelt hat".
Die
internationale Konkurrenz und der Konzentrationsprozess auch in diesem
Industriebereich führen zu einem harten Existenzkampf der noch ansässigen
Betriebe.
Die
Vohenstraußer Kristallglasfabrik musste 1993 schließen.
|
|
|
|
|
|
|
|
