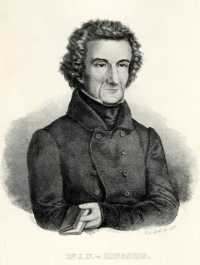Peter
Staniczek
Die Zeit der Romantik
Bettina von
Arnim (1785 - 1859)
Johann Nepomuk
Ringseis und Vohenstrauß
„Für mich
ist Bettina von Arnim die Schönste“, soll sich Bundespräsident Richard von
Weizsäcker anlässlich der Vorstellung der neuen deutschen Geldscheine (vor
Einführung der Euro-Währung) spontan
geäußert haben.
Wer ist Bettina
von Arnim, dass sie als kulturgeschichtlich so bedeutende Deutsche gilt, wert
den neuen Fünfmarkschein zu zieren?
Bettina von
Arnim und die Zeit der Romantik
Bettina von
Arnim ist eine der fesselndsten Frauengestalten des 19. Jahrhunderts. Ihre
Biographie liest sich zunächst wie eine Literaturgeschichte der Romantik.
Sie ist die Schwester von Clemens Brentano (1778 - 1842), lernt dessen
Studienfreund Achim von Arnim (1781 - 1831) kennen und lieben. Sie zählt zum
Kreis der „Berliner Romantik", verklärt ihre Beziehungen zu
Goethe später in "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde". 1811
heiratet sie Achim von Arnim, wird siebenfache Mutter und beginnt nach zwanzig
Ehejahren ein zweites Leben.
Während der
Choleraepidemie 1831 engagiert sie sich für soziale Hilfsmaßnahmen. Karl
Gutzkow, einer der bekanntesten Vertreter des "Jungen Deutschland"
(deren Schriften 1839 verboten werden), bezeichnet sie als „kühne
Vorrednerin“ der Opposition im Vormärz. Sie setzt sich für die Göttinger
Sieben (u.a. Jacob u. Wilhelm Grimm) ein, die 1837 von König Ernst August von
Hannover entlassen werden, weil sie gegen die verfassungswidrige Aufhebung der
Landesverfassung Einspruch erhoben hatten. Ihre Anliegen sind sowohl die
schlesischen Weber als auch die Debatte um die preussische Verfassung, sie
pflegt Freundschaft mit polnischen Revolutionären, bemüht sich um die Opfer
des ungarischen Freiheitskampfes.
„Ich weiß,
was ich bedarf! Ich bedarf, daß ich meine Freiheit behalte.“ Nichts zeigt
besser ihren unbedingten Willen zur Selbständigkeit, ihren Freiheitsdrang, sie
überspringt die Konventionen ihrer Zeit, immer angefochten und streitbar, aber
auch fähig zu tiefen Freundschaften und von vielen verehrt.
Bettina und
Johann Nepomuk Ringseis (1785 - 1880)
Im Jahre 1808
reist Bettina mit ihrem Schwager, dem großen Rechtsgelehrten Karl Friedrich von
Savigny und ihrem Bruder Clemens Brentano nach München, wo sie bei dem damals
sehr berühmten Hofkapellmeister Peter von Winter ein intensives Musikstudium
aufnimmt, und später nach Landshut, wo Savigny einen Ruf an die Universität
angenommen hatte. Hier schließt sie u.a. Freundschaft mit dem Theologen und späteren
Regensburger Bischof Johann Michael Sailer und den Brüdern Johann Nepomuk und
Sebastian Ringseis, jungen Leuten, die noch unter den aufklärerischen Reformen
des Montgelas erfüllt sind von der Begeisterung für Natur und Kunst,
historische Wissenschaft und christlich-vaterländische Erneuerung.
Ingeborg
Drewitz schreibt in ihrer Biographie:
„Ihr
(Bettinas) lebenslanger Briefpartner Johann Nepomuk Ringseis gestand später, daß
ihn nie "ein zartes Gefühl" an sie gefesselt habe, "wohl aber
beseelte mich bald staunende Bewunderung über ihre sprudelnde unvergleichliche
Genialität, ihren tiefsinnigen Witz, für den sicheren Anstand, womit sie die
geniale Freiheit ihrer Bewegung zu begleiten wußte [...] und warme Freundschaft
erregte mir die wohlwollende Güte sowie die Rechtschaffenheit ihres Wesens,
welcher die etwas zu kühnen, manchmal etwas zu schalkhaften poetischen Lizenzen
und dichterisch ausschmückenden Arabesken und Humoresken in ihren Schriften
keinen Abbruch taten“.[2]
Bettina
schilderte ihn in ihren Briefen an Goethe überschwänglich und durchaus schwärmerisch:
|
|
„Nepomuk
Ringseis, ein treuer Hausfreund, hat ein Gesicht wie aus Stahl gegossen, alte
Ritterphysiognomie, kleiner scharfer Mund, schwarzer Schnauzbart, Augen, aus
denen die Funken fahren, in seiner Brust hämmerts wie in einer Schmiede, will
vor Begeisterung zerspringen, und da er ein feuriger Geist ist, so möchte er
den Jupiter aus der Rumpelkammer der alten Gottheiten vorkriegen, um ihn taufen
zu lassen.“ [3] |
Johann Nepomuk
Ringseis in Vohenstrauß
Im strapazenreichen Winter 1813/14 erhält er den Auftrag, das Physikat (Praxis des Bezirksarztes) in Vohenstrauß vorübergehend zu übernehmen. In seinen Erinnerungen erzählt er über das unsägliche Elend in dieser Zeit.
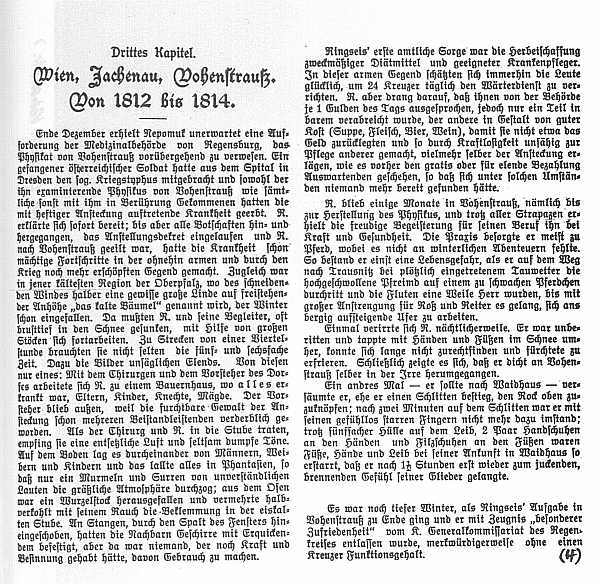
aus Bettina Ringeis: "Dr. Joh. Nep. Ringseis - Ein Lebensbild", Regensburg 1909
„Ein österreichischer
Gefangener hatte den Kriegstyphus eingeschleppt und ganze Familien lagen davon
angesteckt darnieder. Als in Vohenstrauß die Epidemie ein Ende hatte, musste
Ringseis in der Gegend seiner Heimat Schwarzhofen Hilfe leisten. Sein Bruder
Sebastian, ebenfalls ein junger Arzt, musste im Regensburger Kriegslazarett, wo
auch der Typhus herrschte, Dienst tun, und wurde nach vier Wochen, am 9. Februar
1814, selber ein Todesopfer der Seuche. Es gab wenig Hilfsmittel für die
Helfer. Ringseis schreibt, dass damals in Ingolstadt bei der Typhusepidemie 13
junge prom. Ärzte und 500 Wärter und Wärterinnen starben.“ [4]
Ringseis führt
ein bewegtes Leben, nimmt u.a. am Feldzug gegen Napoleon nach Frankreich teil, lässt
sich in München als Arzt nieder, gewinnt die Freundschaft des Kronprinzen
Ludwig, den er von 1817 an mehrfach als Begleiter und Reisearzt auf seinen
Reisen nach Italien begleitet, wird Leiter des gesamten staatlichen
Gesundheitswesens in Bayern und Hochschullehrer und Rektor an der von Landshut
nach München verlegten Universität.
Am 20. Januar
1859 stirbt Bettina von Arnim, nicht ganz vierundsiebzig Jahre alt.
„Ihr Ende war
ruhig und sanft und auch das Antlitz der Leiche machte einen beruhigenden
Eindruck, indem darauf keine Spur eines schweren Todeskampfes zu erblicken war.
Sie ist von der ganzen Familie auf das Gut Wiepersdorf begleitet und daselbst an
der Seite ihres Gatten beerdigt worden“, schrieb Savigny an Nepomuk Ringseis. [5]
Damit schließt sich der Kreis der Geschichte um Bettina von Arnim, die neuen Geldscheine und das Rätsel, was das alles mit Vohenstrauß zu tun hat.
![]()
[1] Anm.: gemeint ist der letzte deutsche Fünfmarkschein vor der Einführung des Euro
[2] Ingeborg Drewitz, "Bettine von Arnim", Goldmann-Verlag, 1989, S. 73
[3] Sigfrid Färber, "Bedeutende Oberpfälzer", Regensburg 1983, S. 113
[4] Barbara Bredow-Laßleben, "Aus der guten alten Zeit ...", in "Die Oberpfalz", Laßleben-Verlag, Kallmünz Januar 1954, S. 18
[5] Ingeborg Drewitz, "Bettine von Arnim", Goldmann-Verlag, 1989, S. 268
Eine kurze Biographie von Joh. Nep. Ringseis finden Sie auch unter http://www.bautz.de/bbkl/r/ringseis_j_n.shtml
|
Verlag Traugott Bautzl, Band VIII (1994), Spalten 380-384, Alexander Loichinger
|
|